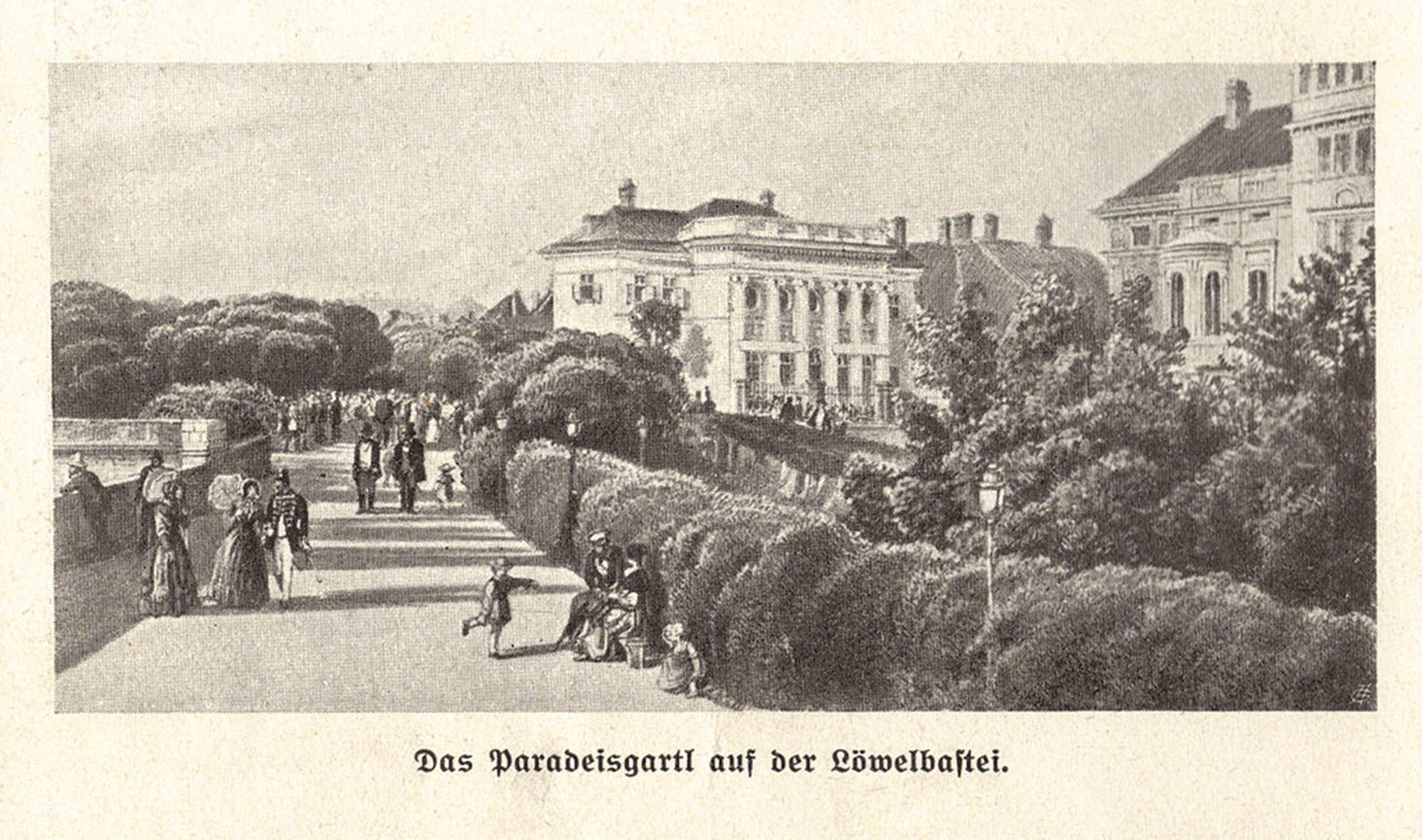Wien gilt bis heute als Mittelpunkt außergewöhnlicher Süßspeisen, die ihre Erfolgsgeschichte und Beliebtheit in die Welt hinaustragen. Es geht oft gar nicht um besondere Gerichte, deren Herstellung viele Ingredienzien und umfangreiches küchenmeisterliches Wissen erfordert. Ein Vertreter simpler aber raffinierter Süßspeisen sind Äpfel im Schlafrock.
„Liebe geht bekanntlich durch den Magen,“ verrät ein altes Sprichwort und mit einem vorzüglichem Mahl, zu dem auch ein pfiffiges Dessert gehört, lassen sich zwischenmenschliche Unstimmigkeiten oft sehr gut aus der Welt schaffen. Beim Ausdruck „Äpfel im Schlafrock“ werden all jene, die davon noch nie gehört haben, lächeln und fragen: „Warum heißt die Nachspeise so?“
Süßer Schlafrock für die Äpfel
Die Bezeichnung „Schlafrock“ verrät, dass es sich um ein Gericht mit einer „Hülle“ handelt, die in diesem Fall aus einem Teig besteht, behutsam hergestellt aus Eiern, Milch und Mehl hergestellt. Ein Schuss Rum kommt als Geschmacksverstärker hinzu. Die Teighülle muss gut gemixt und dickflüssig sein, ehe man die entkernten Apfelspalten in diesen eintaucht. Danach werden die Stücke in heißem Fett gebacken, bis sie goldgelb sind. Danach platziert man sie auf einen Servierteller und bestreut sie zum Abschluss noch mit Vanillezucker. Selbstverständlich ist es auch möglich aus einem geschälten Apfel nur das Kerngehäuse zu entfernen und diesen dann mit Mandeln und Nüssen, oder mit feiner Marmelade oder Vanillesauce zu füllen. Dann wird der gefüllte Apfel in entsprechend große Butterteigstücke eingeschlagen und im Rohr gebacken.
Ab dem 18. Jahrhunderts entwickelte sich diese Speise, die auf verschiedene Arten hergestellt wurde, zu einem beliebten Wiener Nachtisch.
Time Travel Tipp: Man muss kein großes Back- und Kochtalent sein, um diese bekömmlich-leichte Speise als Leckerbissen zu servieren. Im erlesenen Freundeskreis gemeinsam backen und kochen muss nicht nur zu den Feiertagen ein Motto sein, um Spaß zu haben.
Was wäre eine Wiener Nachspeise ohne Kaffee? Einen Überblick der Wiener Kaffeespezialitäten bekommen Sie in unserem Blogbeitrag.
Redaktion und Bild: Michael Ellenbogen
Quellen: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Apfel im Schlafrock, 1.3.2024
„Die gute Küche“, Das Kochbuch der „Illustrierten Kronenzeitung“
D. Dabis & Co, Wien, 1950, Seite 139)